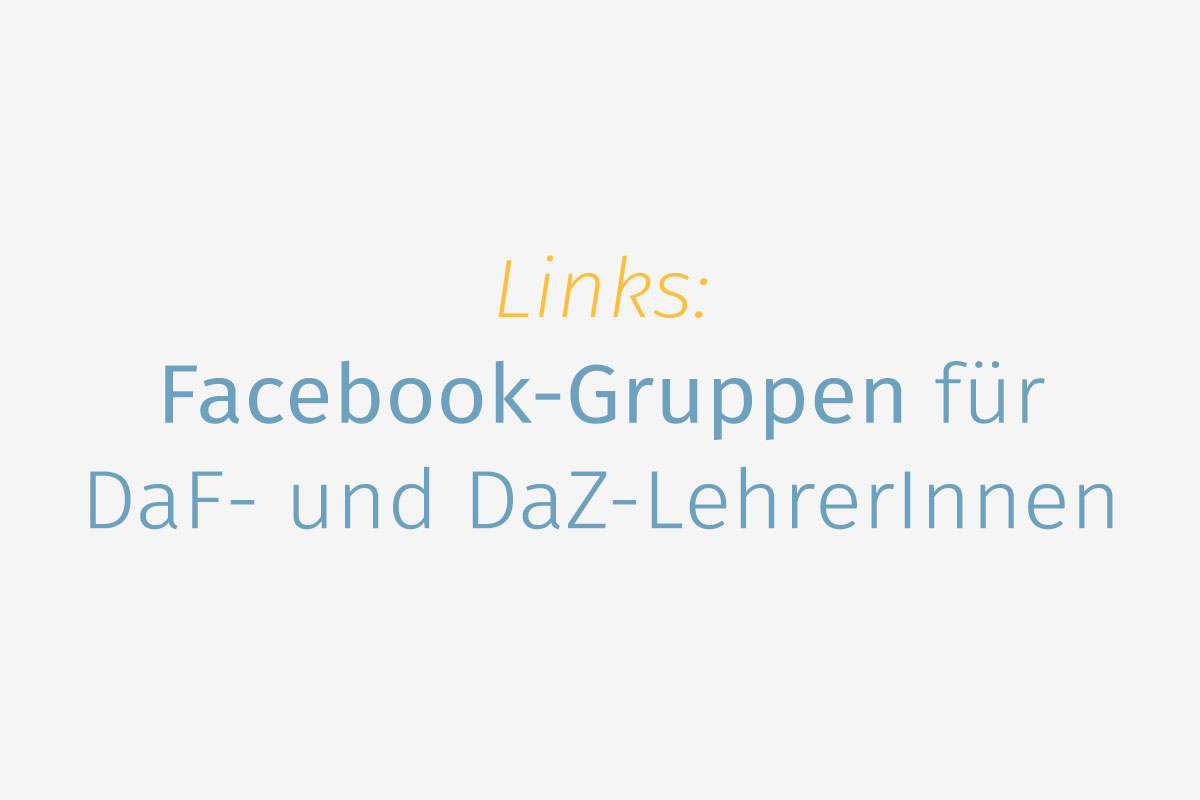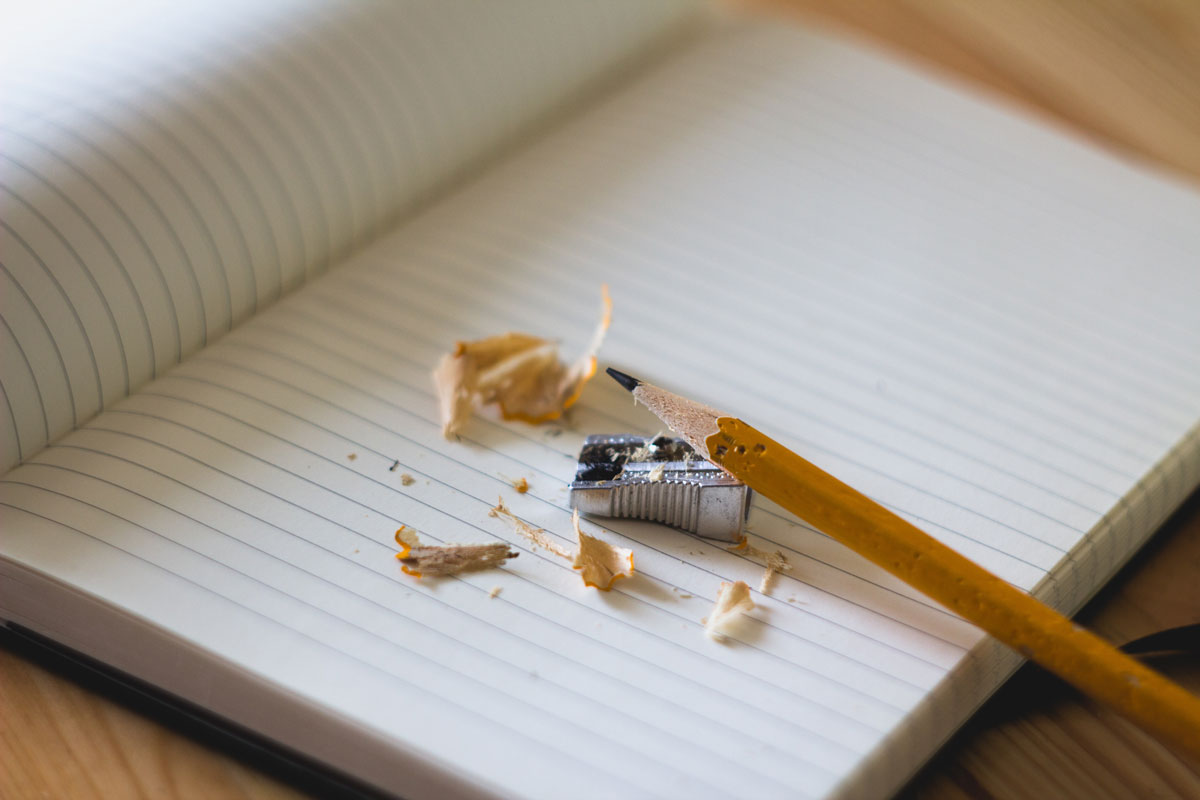Dass die AsylbewerberInnen alles andere als eine homogene Gruppe sind, ist kein Geheimnis. Unter den Geflüchteten befinden sich nicht nur die vielzitierten Ärzte, Ingenieure und weitere Fachkräfte, sondern auch Menschen, die in ihrem Heimatland nur wenige Jahre oder gar nicht zur Schule gegangen sind und über wenig (institutionelle bzw. formale) Bildung verfügen.
Diese Voraussetzungen haben natürlich einen Einfluss auf den Lernprozess im Deutschkurs. Ich möchte an dieser Stelle das Begriffspaar „lerngewohnt“ und „lernungewohnt“ einführen. Beachtet bitte, dass dies nichts mit der Intelligenz, (Sprach-)Begabung oder Motivation zu tun hat. Nur weil jemand lernungewohnt ist, heißt dies nicht automatisch, dass er oder sie „dumm“ ist oder nicht Deutsch lernen kann! Die Lehrkraft steht jedoch vor der Aufgabe, den Unterricht gemäß den Bedürfnissen der lernungewohnten TeilnehmerInnen zu gestalten.
Ein Überblick über die Unterschiede zwischen lerngewohnten und lernungewohnten LernerInnen:
| Lerngewohnte TeilnehmerInnen |
Lernungewohnte TeilnehmerInnen |
| Haben in ihrer Heimat für mehrere Jahre die Schule und ggf. eine Hochschule besucht |
Haben nicht oder nur unregelmäßig die Schule besucht |
| haben keine Probleme, in ihrer Muttersprache zu lesen und zu schreiben |
sind in ihrer Muttersprache nicht oder nicht vollständig alphabetisiert |
| haben eine Fremdsprache (idealerweise mit dem lateinischen Alphabet, z.B. Englisch oder Französisch) gelernt |
Haben noch keine Fremdsprache gelernt |
| verfügen über grammatisches und metasprachliches Wissen (z.B. was ein Verb ist) |
Verfügen nicht über metasprachliches Wissen |
| Kennen Lerntechniken und wissen, was für ein Lerntyp sie sind |
Kennen keine Lerntechniken |
| sind Unterrichtssituationen und können über mehrere Stunden hinweg zuhören und sich konzentrieren |
Haben evtl. Probleme damit, sich über einen längeren Zeitraum hinweg zu konzentrieren und zuzuhören |
| kennen verschiedene Aufgabenarten und Bearbeitungsmodi |
Haben Probleme, Aufgabenstellungen und Übungsformen zu verstehen; haben Probleme, zwischen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit zu unterscheiden |
| Können sicher mit Hilfsmitteln (z.B. versch. Stifte; Wörterbuch) umgehen |
Haben evtl. Probleme, über einen längeren Zeitraum mit der Hand zu schreiben; unsicher im Umgang mit Hilfsmitteln |
Aus diesen Unterschieden ergeben sich einige Punkte, die im Unterricht beachtet werden sollten:
Zunächst einmal ist es sinnvoll, lerngewohnte und lernungewohnte TeilnehmerInnen in eigene Gruppen einzuteilen. Der Grund hierfür ist, dass es sehr schwierig ist, allen TeilnehmerInnen gerecht zu werden, wenn sie unterschiedlich schnell Fortschritte machen. Die einen langweilen sich, wenn etwas immer wieder wiederholt wird; die anderen sind überfordert, wenn die nächste Lektion begonnen wird. [Wer noch nicht alphabetisiert ist, braucht natürlich einen Alphabetisierungskurs!]
Ich gehe also jetzt davon aus, dass die Lernwilligen in unterschiedliche Gruppen eingeteilt wurden. Die folgenden Tipps beziehen sich auf den Unterricht in einer Gruppe mit Lernungewohnten: Weiterlesen